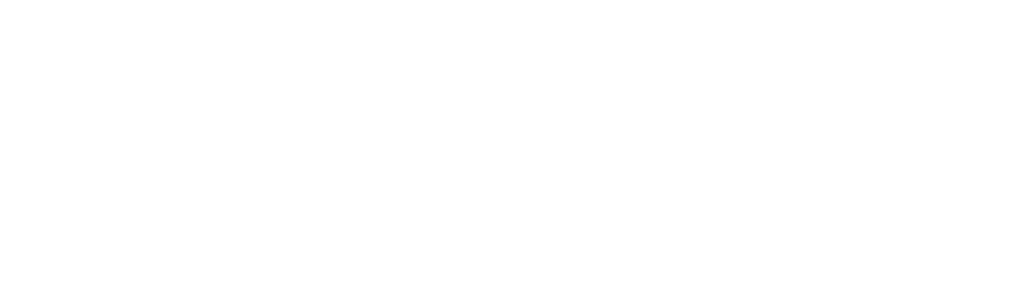Bericht aus Peru
Hermann Wendling SSCC
Die Armen und die Pandemie: Wie überleben die, die von einem Tag zum anderen leben?
Am 16. März, 63 Tage nach dem Ausruf des „Social Distancing“ hat Peru die zweit höchste Zahl (über 92.000) an Corona-Infizierten und die dritt höchste Zahl (über 2650) an Corona-Toten in Lateinamerika. Statistisch steht das Land damit ungefähr auf dem selben Niveau wie Deutschland was die Todesfälle angeht, weit höher jedoch ist die Zahl der Erkrankten.Die Regierung hat Mitte März drastische Maßnahmen ergriffen: Ausgangsbeschränkungen für alle, die nicht in lebenswichtigen Bereichen arbeiten, Schließungen der Kindergärten, Schulen, Universitäten, Erlaubnis für nur ein Familienmitglied, das Haus zum Einkauf, zur Apotheke oder zur Bank zu verlassen, Ausgangsverbot von 6 Uhr abends bis 5 Uhr morgens.
Neben milliardenschweren Unterstützungen für die Unternehmen, verteilt die Regierung nach und nach Boni für weite Kreise der Bevölkerung: Familien in Armut, informelle Arbeiter, Landbevölkerung, schliesslich einen „universellen Familienbonus“. Auch die Gemeindeverwaltungen haben an einen Grossteil der Bevölkerung Lebensmittelpakete verteilt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch die Kirchengemeinden.
Trotz der einschränkenden Maßnahmen und der finanziellen Hilfen steigt auch nach neun Wochen die Zahl der Erkrankten und Toten, vor allem in den überbevölkerten Außenvierteln Limas, im Norden und im Amazonasgebiet. In unserer Region Junín in den Anden sind wir, wenigstens auf dem Land, bisher verhältnismässig schwach betroffen. Was die Eindämmung der Krankheit besonders erschwert ist die Informalität, in der die Mehrheit der Bevölkerung lebt.
Etwa 70 % der arbeitenden Bevölkerung gehört zum informalen Bereich der Wirtschaft, d. h. sie arbeiten ohne Vertrag, ohne soziale Absicherung. Dadurch bedingt ist das Vertrauen in den Staat, die Unterordnung unter seine Gesetze und der Begriff des Gemeinwohls schwach. Das fehlende Interesse der Reichen an sozialer Gerechtigkeit und die Korruption unter den Politikern verstärkt die Distanz der Bürger zum Staat. Die neoliberale Politik der Privatisierung der staatlichen Gesundheits- und Erziehungsdienste der letzten 30 Jahre hat die Ungleichheit zwischen oben und unten abgrundtief gemacht.
Die Krise infolge der Pandemie betrifft unsere Dörfer direkt, wenn auch nicht mit der Wucht, mit der sie sich in den Städten bemerkbar macht. Die Preise für die landwirtschaftlichen Produkte sind auf den Boden gefallen. Die Bauern halten ihre Erzeugnisse in Reserve in der Hoffnung, sie nach der Pandemie zu angemessenen Preisen verkaufen zu können. Es herrscht Angst vor dem Virus, da trotz Reisebeschränkung zahlreiche Menschen aus Lima in ihre Heimat zurückströmen. Sie umgehen das Reiseverbot in Lastwagen oder in langen Fussmärschen. Mit ihnen reist der Virus. Die Gemeindeverwaltungen haben an den Ortseingängen Teams aufgestellt, die die einfahrenden Autos und Personen desinfizieren und dokumentieren. Viele Familien haben bisher von den Hilfen der Regierung profitiert, aber auf Grund organisatorischer Mängel warten andere darauf, endlich in den Registern der Begünstigten zu erscheinen. Besonders hart betroffen sind die Immigranten aus Venezuela, die in den größeren Städten vom ambulanten Handel leben und ohne Arbeit geblieben sind.
Das Schuljahr sollte am 15. März beginnen, mit der Quarantäne wurde sein Beginn verschoben. Seit Anfang Mai erhalten die Schüler ebenso wie die Studenten virtuellen Unterricht. So ist es bis Ende des Jahres vorgesehen. Die Schüler werden mittels Fernsehen, Radio, Büchern, Fotokopien unterrichtet, die Lehrer begleiten sie mittels WhatsApp oder Handy. Schwierigkeiten haben Schüler, die wegen der Lage ihres Ortes oder aus finanziellen Gründen keinen Zugang zu den elektronischen Kommunikationsmitteln haben. In der entlegenen Gemeinde Sallahuachac haben die Eltern ein Komitee gebildet, das wöchentlich in die Provinzhauptstadt Jauja reist, um Fotokopien für die Schüler abzuholen und ihre Aufgaben abzugeben. Die Ordensschwestern in unserer Nachbarpfarrei Sincos haben in einem ihrer Räume einen Fernseher für Schüler ohne dieses Kommunikationsmittel in ihrer Familie aufgestellt. Dort studieren sie unter Einhaltung des gebotenen Abstands. Die Krise macht erfinderisch auch für die tätige Nächstenliebe.
Was wünschen sich die Armen für die Zukunft? Für die nächste Zukunft, dass sie nicht an Covid-19 erkranken. Da sie keinen Zugang zu privaten Kliniken haben, wären sie auf das öffentliche Krankenhaus angewiesen. Und das ist in Lima und in den am stärksten betroffenen Gebieten nicht mehr im Stande, die neu Erkrankten aufzunehmen. Auf weitere Sicht, dass die skandalöse Situation der Ungleichheit, die jetzt ins öffentliche Bewusstsein tritt, und die mit einer weit verbreiteten Korruption einhergeht, die die öffentlichen Mittel in private Taschen umleitet, von der Politik angegangen wird.