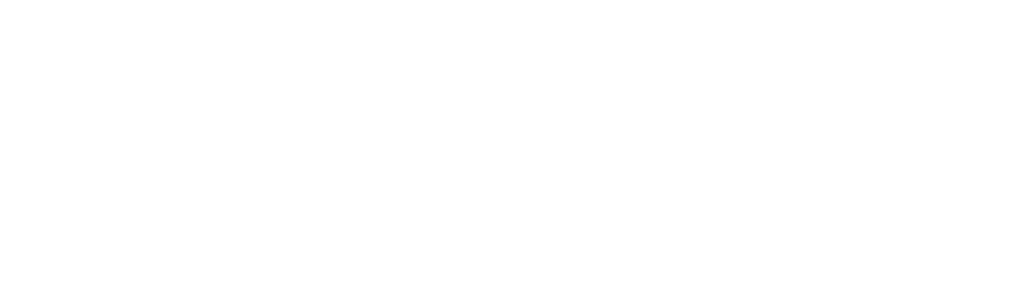»Mietet eine Garage und trefft euch«
Wie findet Kirche in Zukunft statt?
»Es ist selbstverständlich, dass der ganze kirchliche Apparat, beim Papst angefangen und allen römischen Behörden, mit allen Bischöfen und Kirchen, von den Sakramenten bis zu den Kirchensteuern nur dazu da ist, dass ein klein bisschen Glaube, Hoffnung und Liebe im Herzen der Menschen geweckt wird.« Auf diese einfache Formel brachte der Jesuit Karl Rahner (1904–1984) schon vor Jahrzehnten die Aufgabe, die Mission der Kirche. Dabei nimmt er Bezug auf das »Hohelied der Liebe«, das der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther mit den Worten schließt: »Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe« (1 Kor 13,13).
Nur etwas Glaube, Hoffnung und Liebe wecken. Das klingt für mich auf den ersten Blick so bestechend einfach – und ist es doch offensichtlich nicht. Zumal der »ganze kirchliche Apparat« heute in keinem guten Licht dasteht. Auch weil viele kirchliche Positionen heute kaum noch anschlussfähig sind, für Kirchenmitglieder ebenso wenig wie für Menschen außerhalb. Vor allem aber haben die jahrzehntelangen Verbrechen von Klerikern und deren systematische Vertuschung die Kirche in eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise gestürzt.
Doch vielleicht muss die Frage noch grundsätzlicher gestellt werden: Ist dieser große Apparat überhaupt geeignet, in den Herzen der Menschen etwas zu bewegen? Oder steht er genau einem solchen Anspruch im Wege?
Die Frage »Wie geht Kirche heute?« beschäftigt mich schon sehr lange, spätestens seit ich Ende der 1980er-Jahre begonnen habe, Theologie zu studieren. Aber so bedrängend wie heute war sie bisher noch nicht. Vieles, was seinerzeit noch plausibel und selbstverständlich war, ist heute obsolet oder steht zumindest auf dem Prüfstand.
In dieser Ausgabe des »Apostel« wollen wir der Frage nachgehen, wie Kirche heute gehen kann, jenseits dieses ganzes Apparates – und haben ein Wort von Papst Franziskus als Überschrift gewählt: »Mietet eine Garage und trefft euch!«
Großer Gott – ganz klein
In einer Art »Garage« hat es ja begonnen, als im Stall von Betlehem vor gut zweitausend Jahren Geschichte geschrieben wurde. Ein Kind kam zur Welt, und seine Geburt rührt uns noch heute. Sollte dieses Kind, in so prekären Verhältnissen geboren, der ersehnte Messias sein? Als dieser Jesus dreißig Jahre später öffentlich auftritt, sich vom Bußprediger Johannes im Jordan taufen lässt, schließen sich ihm viele an. Sie glauben seiner Rede vom Reich Gottes, lernen in ihm den Sohn Gottes zu sehen.
Der Anfang des christlichen Glaubens liegt im Verborgenen, im Kleinen. Daran erinnern wir uns und singen an Weihnachten wieder: »Er kommt aus seines Vater Schoß und wird ein Kindlein klein, er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein, entäußert sich all seiner G’walt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding.« (GL 247,2–3)
Am Ende seines dreijährigen öffentlichen Wirkens bestimmt Jesus die einfachen Gaben von Brot und Wein zu Zeichen seiner bleibenden Gegenwart. Gottes Größe offenbart sich nicht im prunkvollen Gehabe, in der großen Geste oder der machtvollen Änderung der Verhältnisse im großen Stil. Sich im Kleinen, eher Unscheinbaren zu erkennen zu geben, scheint ein Markenzeichen Gottes zu sein.
Kirche der Zukunft
Die Kirche dagegen liebt es groß. Und in unserem Land ist Kirche lange groß gewesen – und ist es noch heute. Auch wenn ihre Mitgliederzahlen seit Jahrzehnten kräftig nach unten gehen. Gehörten 1950 noch fast alle Bürgerinnen und Bürger einer der beiden großen christlichen Kirchen an, bilden die Kirchenmitglieder seit ein paar Jahren nicht einmal mehr die Hälfte der Bevölkerung ab. Das hat weitreichende Konsequenzen für ihr Erscheinungsbild: In den Bistümern werden Pfarreien zusammengelegt, der vertraute kirchliche Nahbereich verändert sich in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Das Erzbistum Freiburg, in dem ich arbeite, beispielsweise reduziert zum 1. Januar 2026 seine bislang 224 Seelsorgeeinheiten auf 36 Großpfarreien. Solche ›Reformen‹ sind aber wohl vor allem der Versuch, so viel wie möglich von der bisherigen Struktur zu retten.
In seinem aktuellen Buch »Christentum – kann das weg?« erinnert der frühere Münsteraner Fundamentaltheologe Jürgen Werbick an das Wort Karl Rahners: »Wer retten will, muss wagen.« Und fügt hinzu: »Unsere Situation verlangt nach einer Zuspitzung: Wer an der Zukunft dieser ruinierten Kirche arbeiten will, muss sie neu, anders denken und leben.« Werbick plädiert dafür, sich nicht von einem ›Weiter so!‹ Heil und Zukunft zu erwarten, sondern einander zu »ermutigen, mehr Gutes und Heilsames, mehr Überschreitung und Aufbruch für möglich zu halten«.
Wie Kirche in Zukunft bei uns aussehen kann, ist noch nicht entschieden. Diese Zukunft muss gewagt werden. Strukturen zu retten und an das jetzt mögliche anzupassen, kann nicht das Entscheidende sein. Sie wird aber »Sakrament« bleiben müssen, das heißt Zeichen und Werkzeug. Als Zeichen ist es ihre Aufgabe, nicht auf sich zu zeigen, sondern auf den hinzuweisen, der mit seiner großen und unbegreiflichen Liebe seine Geschöpfe und seine Schöpfung umfängt. Und als Werkzeug ist sie dazu gerufen, Gemeinschaft mit Gott und den Menschen untereinander schon jetzt zu verwirklichen: im Kleinen und Unscheinbaren, fragmentarisch.
Die Frage, wie sie sich dabei als Institution in der Welt organisiert, ist dem nachgeordnet.
»Mietet eine Garage«
Seit zehn Jahren hat die Kirche mit Franziskus einen Papst, der in einfachen schwarzen Straßenschuhen und mit einer Aktentasche unter dem Arm auftritt und sich in einem kleinen Fiat chauffieren lässt. In seinem ersten apostolischen Schreiben »Freude am Evangelium« hat er gleich zu Anfang seines Pontifikats klargestellt, was ihm an der Kirche wichtig ist: »Mir ist eine ›verbeulte‹ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.« Hinausgehen, bei den Menschen sein, ihnen einen Raum anbieten. In diese Richtung geht auch sein Aufruf »Mietet eine Garage!« Das heißt: Macht etwas! Geht da hin, wo die Menschen sind! Auch das Kleine, das Unvollkommene, das noch nicht ganz zu Ende Gedachte hat seinen Wert.
Nicht die Perfektion des kirchlichen Angebots oder einer gemeindlichen Idee ist entscheidend, sondern die Initiative an sich. In den größer und größer werdenden Pfarreien in den deutschen Bistümern wird es immer weniger eine pastorale Rundumversorgung geben können. »Vor Ort«, wo es früher eine Gemeinde mit eigenem Pfarrer, kirchlichen Gruppen und Vereinen, einem Kindergarten und Kirchenchor gab, gehört man heute zu einer großen Pfarrei, in der das gemeindliche Leben von früher nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
Hier ist ein neues und anderes Kirche-Sein gefragt, zu dem wohl Aufrufe wie diese gehören: Trefft euch, seid (neue) Gemeinde! Teilt das Wort Gottes miteinander, hört aufeinander und erkennt, was es hier und heute zu sagen hat! Seht auf euren Ort, den Stadtteil, gestaltet und tut, was für die Menschen bei euch notwendig ist!
Der eingangs zitierte Karl Rahner hat Basisgemeinschaften als Zukunft der Kirche auch hier in Deutschland gesehen. In seinem anlässlich der Würzburger Synode (1971–75) geschriebenen Büchlein »Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance« (1972) hat er eine Kirche, die sich so von unten her aufbaut, skizziert. Damals, Anfang der 1970er-Jahre, war die Zeit dafür offensichtlich noch nicht reif. Jetzt sieht das anders aus. Kleine Gemeinschaften und neue Initiativen könnten ein Weg sein – zu dem Ziel, das immer noch heißt, ein klein bisschen Glaube, Hoffnung und Liebe in den Herzen der Menschen zu wecken.
von Peter Wegener
Frische Ausdrucksformen
Wer nach neuen Formen des Kirche-Seins sucht, wird früher oder später auf »Fresh X« stoßen. Der Begriff steht für »fresh expressions of church« und bedeutet so viel wie »frische Ausdrucksformen von Kirche«. Fresh X hat seinen Ursprung in England.
Einer der Pioniere dieser Bewegung, der anglikanische Priester Michael Moynagh, war im Oktober eine Woche lang zu Gast in der Erzdiözese Freiburg. Er sagt: »Ich setze mich dafür ein, dass wir eine Kirche für alle Menschen sein können. Dazu braucht es viele und neue Zugangswege und Formen von Gemeinschaft.« Fresh X versteht sich als eine Ergänzung zu den überkommenen Formen, Kirche zu sein und zu leben.
Traditionell lädt die Kirche ein. Sie organisiert Veranstaltungen und Gottesdienste und bittet die Menschen zu kommen. Gegen dieses »Kommt zu uns« setzt Fresh X den Aufbruch, den Weg zu den Menschen hin, die mit Kirche nichts am Hut haben. Das erinnert an das Wort von der Garage: Schafft dort Räume, wo die Menschen sind.
Jeder Aufbruch beginnt, so sagt es Moynagh bei einer Veranstaltung in Heidelberg, mit dem Zuhören. Am Ende dieses Weges entsteht so vielleicht eine neue »Ausdrucksform von Kirche«. Er ermutigt dazu, den Anfang als ein Experiment zu sehen. Fangt klein an, sucht ein Team und beginnt mit dem, was ihr habt. Sprecht mit den Menschen, zu denen ihr unterwegs seid, und sucht zusammen mit ihnen nach Lösungen. So lauten seine Ermutigungen.
Denn eines ist für Michael Moynagh sehr klar: »Keine Strukturzusammenlegung wird den Relevanzverlust und Mitgliederschwund der Kirchen beenden. Wer Wachstum will, muss die Kontaktflächen außerhalb traditioneller Formen erhöhen.«
von Peter Wegener
Der Beitrag ist in der Ausgabe 4/2023 unserer Ordenszeitschrift »Apostel« erschienen.